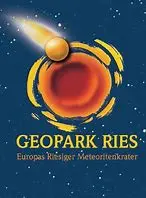Impressionen aus Hainsfarth






















Kultur und Freizeit
Wenn Sie in Hainsfarth sind, können Sie unsere örtlichen Sehenswürdigkeiten besuchen.
-
Steinharter Burgruine
Stammburg der Späten von Steinhart
Im 12. Jahrhundert erbaute vermutlich Marquard Spet de Steinenhart, der 1120 in einer Urkunde als Zeuge genannt wurde, die Burg über dem Dorf Steinhart und 1130 wurde ein „Bertholdus Späth, nobilis de Steinhart” erwähnt. Weitere Erwähnungen der Spete fanden 1167 mit Heinrich Spet und Bertold Spet 1180 bis 1183 statt. Ab 1282 nannten sich die Herren von Spet Spete von Steinhart (die „Späten von Steinhart”).
1282 wurde der Spetsche Besitz in zwei Linien geteilt, wobei ein Teil zu Faimingen an der Donau kam, einem heutigen Ortsteil der Stadt Lauingen.
Vermutlich wurde die „Alte Burg” im Krieg um die Eichstätter Lehen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Auf dem Burghügel der abgegangenen Burg mit ringförmigem Graben, dem Burgstall Steinhart, auch Judenbuck genannt, befindet sich seit dem 18. Jahrhundert der Jüdische Friedhof.
Nachdem 1328 Herman Spet die Erlaubnis zum Bau einer neuen Veste in Steinhart erhielt, wurde über dem Burgstall strategisch günstiger die neue Burg Steinhart erbaut, heute auch „Altes Schloss“ genannt.
Nach 1339 wechselte die Burg ihre Besitzer und kam an die Grafen von Öttingen, die 1359 den Besitz an die Familie von Gundelsheim verkauften.
Nachdem die Burg bereits 1532 in schlechtem baulichem Zustand war, wechselte sie ihre Besitzer und wurde vermutlich 1634 im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Seit 1971 ist die Ruine in Privatbesitz.
Von der ehemaligen rechteckigen Burganlage mit einer Vorburg auf trapezförmigem Grundriss sind noch bedeutende Reste der Umfassungsmauern mit Buckelquadern mit Randschlag an den Ecken erhalten.
Links:
-
Geopark Ries
Geologie des Rieskraters und seine Entstehung
Der Rieskrater verdankt seine Entstehung einem katastrophalen kosmischen Ereignis. Durch die Kollision eines ca. 1 km im Durchmesser großen Himmelskörpers mit der Erde entstand vor ca. 15 Millionen Jahren das Nördlinger Ries, das die Schwäbische Alb von der Fränkischen Alb trennt. Das kosmische Projektil (Asteroid) stammte aus dem sog. Asteroidengürtel, dessen Hauptmasse sich zwischen den Umlaufbahnen der Planeten Mars und Jupiter befindet. Durch die unvorstellbar hohe Energie des Projektils, die hauptsächlich aus seiner immensen Geschwindigkeit (ca. 70.000 km/h) resultiert, wurden in den getroffenen Gesteinen extrem hohe Druck- und Temperaturverhältnisse ausgelöst. Als Folgeerscheinung wurden neue Gesteinsformationen geschaffen, die man als sog. Impaktgesteine bezeichnet.
Durch den Einschlag entstand ein primärer Krater von ca. 4,5 km Tiefe und ca. 12 km Durchmesser (heute noch erkennbar an isolierten Ringhügeln wie dem Wallersteiner Felsen, der Marienhöhe bei Nördlingen und dem Wennenberg bei Alerheim, die bis zu 80 m aus der Riesebene herausragen). Dieser anfängliche (primäre) Krater wurde beim Verdampfen des Einschlagskörpers durch Rückfederung des Kraterbodens bei gleichzeitiger Druckentlastung verflacht und vergrößerte sich gleichzeitig durch nachrutschendes Gestein (Megablockzone) auf 25 km im Durchmesser. Beim Nördlinger Ries liegt somit ein komplexer Krater mit einer inneren Ringstruktur vor.
Das kosmische Projektil durchschlug die verschiedenen geologischen Schichten, was bedeutet, daß zuerst die jüngsten Schichten (Molasse) getroffen wurden. Aus diesen wurden durch Aufschmelzung der darin vorhandenen Sande die sog. Moldavite (grüne Impaktgläser) gebildet, die heute in der Tschechischen Republik und in der Lausitz gefunden werden. Danach wurde die Weißjuratafel durchschlagen. Weißjurakalkbrocken flogen bis in die heutige Schweiz (St. Gallen) und sind als sog. Brockhorizont (auch Reutersche Blöcke genannt) in der Umgebung von Augsburg ein wichtiges Schichtglied und damit eine geologische Zeitmarke. Nachfolgend wurden der Braune und Schwarze Jura durchschlagen und diesen die Sedimentschichten der Trias beigemischt. Diese neu gebildete Gesteinsformation nennt man die Bunten Trümmermassen, die im Süden und Südosten des Kraters auch häufig Weißjuraanteile aufweisen.
In ca. 1 km Tiefe wurde der kosmische Körper abgebremst und explodierte. Die Sprengkraft kann man mit ca. 250 000 Hiroshima-Atombomben gleichsetzen. Durch diesen enormen Energieeintrag wurde das Grundgebirge so stark verändert, dass es sogar zu Aufschmelzungen und zum Verdampfen des Gesteins kam.
Vergleichbar einem pyroklastischen Strom (explosionsartig zerfetzte Gesteinstrümmer) bei einem Vulkanausbruch schoss das Gesteinsmaterial z. T. in fester, z. T. in flüssiger Form atompilzartig aus dem initialen Krater, der eine Tiefe von ca. 4,5 km aufwies, heraus. Die sehr heiße Gesteinsmasse setzte sich auf den zuvor ablagerten Trümmermassen ab und bildete zu diesen einen steilen, scharfen Kontakt (siehe Suevitsteinbruch des Zementwerks Märker in der Aumühle bei Hainsfarth). Dieser neue Gesteinstypus erhielt 1919 von Sauer den Namen Suevit (Schwabenstein; lat.: suevia = Schwaben).
Der Suevit löste auch das 200-jährige Rätsel des Rieses. In ihm fanden 1960 die Geowissenschaftler E. Shoemaker und E.T. C. Chao das Hochdruckmineral Coesit (Hochdruckphase des Quarzes). Etwas später wurde eine weitere Hochdruckmodifikation von Quarz mit dem Namen Stishovit nachgewiesen. Diese Minerale bilden sich nur bei extrem hohen Druck- und Temperaturverhältnissen, die bei vulkanischen Prozessen nicht erreicht werden. So konnte die seit 1792 (Carl v. Caspers, Entdeckung des Feuerduftsteins) bestehende Vulkantheorie von der Einschlagstheorie abgelöst werden.
Diese neue Vorstellung von der Entstehung des Rieses wurde in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bestätigt, als im Suevit sog. Impaktdiamanten nachgewiesen werden konnten. Deren Existenz bestätigen die extrem hohen Druck- und Temperaturverhältnisse.
Mittlerweile sind neben dem Nördlinger Ries und seinem Nachbarkrater Steinheimer Becken weltweit ca. 180 Einschlagskrater entdeckt worden. Das Nördlinger Ries gehört zu den besterhaltenen und besterforschten Impaktkratern der Erde. Das war einer der Gründe, weshalb die Astronauten der Apollo 14 und 17 hier ihr geologisches Feldtraining für ihre Mondmissionen durchführten.
Die Gesteinsklassifizierung für Impaktgesteine wurde im Ries zum ersten Mal durchgeführt. Das bedeutet, dass der Rieskrater der sog. locus typicus für die Gesteinstypen Suevit und Bunte Trümmermassen ist. Somit müssen alle Impaktgesteine in anderen Impaktkratern, die wie der Suevit entstanden und ausgebildet sind, auch Suevit genannt werden.
Das Geotop „Steinbruch Aumühle im Nördlinger Ries” zeigt die bei einem Meteoriteneinschlag vor knapp 15 Millionen Jahren – beim sogenannten „Ries-Impakt” – entstandenen Gesteinsmassen. Diese sind hier in Form von „Bunter Brekzie” und grauem, tuffähnlichem „Suevit” übereinander abgelagert.
Anfahrt – So finden Sie den Steinbruch Aumühle
Auf der B466 zwischen Nördlingen und Gunzenhausen ca. 2,5 km nördlich von Oettingen den Hinweisschildern zum Geotop folgen.
Die Schautafel steht vor dem Eingang zum Steinbruch. Wenn Sie den Steinbruch betreten möchten, ist die vorherige telefonische Anmeldung bei Firma Märker Tel.: 09080-80 notwendig.
Informationen zum Download
- Flyer Steinbruch Aumühle, Geotop Nr. 9
- Schautafel Suevit-Steinbruch Aumühle
- www.geopark-ries.de